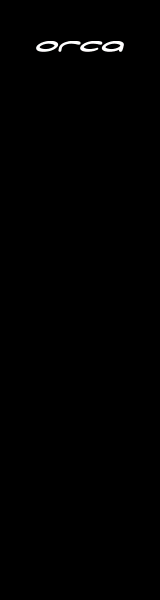Dank einer Vielzahl von Innovationen der vergangenen Jahrzehnte können Athleten heute ihr Training und ihre Leistungsentwicklung genauestens überwachen und analysieren. Die moderne Datenerfassung im Ausdauersport begann Ende der Achtziger des letzten Jahrhunderts, als die ersten Pulsmesser auf den Markt kamen.
Mark Allen beispielsweise war einer der ersten Triathleten, die mithilfe der Maffetone-Formel ihr Training umstellten, und in den Jahren darauf konnte er sechsmal die Krone beim Ironman Hawaii gewinnen. Pulsmesser waren dabei aber erst der Anfang. Später folgte die Wattmessung beim Radfahren, und seit ein paar Jahren können auch interessierte Läufer mittels Schuhpod ihr Training nach der Wattzahl steuern. Doch damit nicht genug, denn mit Datensammeln allein ist es noch nicht getan. Erst durch die Analyse ebendieser Daten ergibt sich ein komplettes Leistungsbild des Athleten.
DER GLÄSERNE ATHLET
Trainierte ein Coach früher lokale Trainingsgruppen und Athleten, kann er heutzutage Sportler zeit- und ortsunabhängig rund um den Globus betreuen. Apps wie Garmin Connect und Trainingsprogramme wie TrainingPeaks helfen dabei, den Fortschritt des Trainings zu verfolgen und die Planung fortlaufend anzupassen. Waren früher zur Formüberprüfung des Status quo in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Leistungsdiagnostiken notwendig, so liefern Garmin & Co. inzwischen ein permanentes Monitoring des individuellen Leistungszustands.
GELASSENHEIT
Während Sportler und Trainer von diesen Entwicklungen profitieren, kommt die Technik doch manchmal an ihre Grenzen oder überrascht mit Tücken. Daher ist bei aller Datenaffinität immer auch eine gewisse Portion Gelassenheit vonnöten, sollte die Technik einmal streiken oder auf die falsche Fährte führen. Beispiele aus meinem Traineralltag gefällig?
„Laut meiner Uhr sinkt mein VO2max!“
Gerade im Sommer in der Mittagshitze oder auch kurz nach Einnahme einer Mahlzeit ist der Puls erhöht. Die Uhr misst die gewohnte Laufgeschwindigkeit, aber in dem Fall bei deutlich erhöhtem Puls. Demnach passt sie den VO2max-Wert nach unten an. Würde der Lauf kurz nach dem Aufstehen am Morgen – und somit bei deutlich kühleren Temperaturen – stattfinden, reagierte der Puls auch noch nicht so schnell, und es würde genau das Gegenteil eintreten.
„Ich bin doch exakt auf Ziel-Pace gelaufen, aber dann geplatzt!“
Wenn der Athlet bei längeren Einheiten oder im Wettkampf nicht genügend trinkt, dann dehydriert der Körper mit der Zeit. Der Körper arbeitet zunehmend am Limit, was sich durch einen erhöhten Puls bemerkbar macht. Wenn der Sportler dies nicht beachtet, sondern stur seiner angestrebten Laufgeschwindigkeit folgt, dann ist diese irgendwann nicht mehr aufrechtzuerhalten und mit einem Mal Schluss. Von daher hat letztlich der Puls als direkter Feedbackgeber des Körpers immer Vorrang vor Geschwindigkeit und Wattwerten.
„Ich konnte die Intervalle nicht fahren, obwohl ich doch erst vor zwei Wochen einen neuen FTP-Test eingebaut habe, um aktuelle Werte zu bekommen!“
Wenn Athleten nach dem monatelangen Rollentraining im Frühjahr wieder draußen fahren, kommt auf dem Renn- oder Zeitfahrrad teilweise ein anderes Wattmesssystem zum Einsatz, dessen Werte von den erhobenen Daten des Smart Trainers abweichen. Die Abweichung kann aus meinen Erfahrungen bis zu 15 Prozent betragen, und von daher ist es wichtig, die Tests auf den Trainings- und Wettkampfrädern und mit dem dort eingesetzten System durchzuführen.
„Hilfe, meine Trainingsuhr meldet mir 36 Stunden Regenerationszeit, aber so platt fühle ich mich nicht!“
Die Uhren messen die Trainingsbelastung mittels einer Kombination aus Trainingsdauer und -intensität. Die individuelle Belastungsverträglichkeit der Athleten kann allerdings stark variieren. Während ein Anfänger nach einer fünfstündigen Radtour tatsächlich sehr erschöpft sein kann, verhält es sich bei einem Langdistanzathleten in Höchstform drei Wochen vor dem Rennen ganz anders. Hier stoßen die aktuellen Modelle an ihre Grenzen. Dies ist auch der Grund, warum ein Standardtrainingsplan aus dem Internet nicht für alle Athleten passt. Ein Drittel der Sportler wird dabei unter- und ein weiteres Drittel überfordert, und für das letzte Drittel passt es – vielleicht. So langsam sorgen die Uhrenhersteller dafür, dass mehr und mehr Daten einfließen, wodurch natürlich auch die Analysen und Prognosen genauer werden. Die nach einer Einheit notwendige Regenerationszeit hängt allerdings auch von vielen anderen Faktoren ab, wie beispielsweise Temperatur, Dehydration, Energiebilanz, Herzfrequenzvariabilität bzw. allgemeines Stresslevel und Schlafqualität.
KÖRPERGEFÜHL
Aber wie bekommt jemand, der sich nahezu ausschließlich auf die Daten seiner Smart Watch und seines Tachometers verlässt, ein besseres Körpergefühl? Nach wie vor existieren traditionelle, gut funktionierende Methoden. Eine davon ist die Belastungssteuerung nach Atmung. Atmet man beispielsweise ausschließlich durch die Nase, ist lediglich ein Laufen im tiefen Grundlagenbereich möglich. Wird die Intensität gesteigert, stellt der Sportler zwangsläufig irgendwann auf Mundatmung um, da er hier mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Wird der Atem zum ersten Mal deutlich hörbar und das Unterhalten mit den Laufpartnern herausfordernder, so ist die aerobe Schwelle erreicht. Diese liegt bei circa 75–80 % der maximalen Herzfrequenz und stellt gleichzeitig auch die maximal mögliche Langzeitausdauerbelastung dar, zum Beispiel über eine Triathlon-Langdistanz. Wird die Intensität weiter gesteigert, so wird der Atem irgendwann flach und schnell. Zusätzlich bekommt der Athlet einen Blut- beziehungsweise Metallgeschmack im Mund, bei dem es sich übrigens um Laktat handelt. Hier wird die anaerobe Schwelle erreicht, bei der das Tempo maximal über 60 Minuten aufrechterhalten werden kann.
Wer diese Methodik perfektionieren möchte, dem empfehle ich, während der Vorbereitungsphase im Winter den Atem mit der Pulsuhr abzugleichen. Sprich, man spielt mit den verschiedenen Atemschwellen und prüft diese mit der Pulsuhr ab. Hierbei schaut man bewusst eine Weile nicht auf die Uhr und überlegt sich anhand seiner gerade individuell empfundenen Belastung, wie hoch der Puls und auch das Lauftempo wohl ist. Im Laufe der Zeit entwickelt man ein so gutes Körpergefühl, dass man als Sportler in der Lage ist, den eigenen Puls jederzeit auf 2–3 Schläge genau abzuschätzen und somit auch die Laufgeschwindigkeit. Damit wird es spielend leicht, die eigenen Belastungsbereiche auch ohne Pulsuhr zu kennen. Sollte im Training oder vor allem im Wettkampf die Technik streiken, bleibt der Athlet – nach dem ersten „Schock“ – gelassen und bewegt sich weiter nach Körpergefühl, anstatt in Panik zu geraten und von nun an im Dunkeln zu rudern. Der zweifache Hawaii-Sieger Chris McCormack beispielsweise gehörte zu den Athleten, die im Wettkampf nie auf Messsysteme zurückgegriffen haben, sondern ausschließend nach Gefühl das eigene Rennen bestritten, und das bekanntlich ziemlich erfolgreich.
Text: Michael Krell
Foto: Garmin